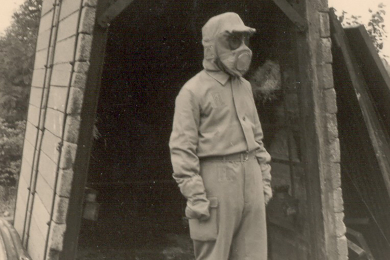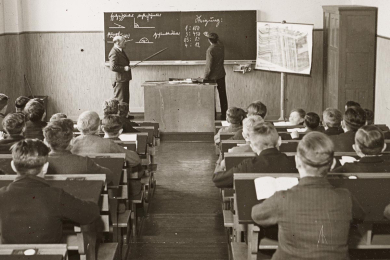Objekt des Monats
Im Forschungsprojekt „montan.dok 21“ wird die Geschichte der Musealen Sammlungen des Montanhistorischen Dokumentationszentrums (montan.dok) weiter aufbereitet, Bestände werden erfasst und analysiert. Die Vielfalt des materiellen Bergbauerbes in unseren Sammlungen reicht dabei von der Großmaschine über die Barbarastatue, vom Firmenprospekt bis hin zur Taschenuhr als Jubiläumsgabe. Montangeschichte erzählen alle Objekte auf unterschiedliche Art und Weise.
Das „Objekt des Monats“ ist unser Schaufenster in diese Sammlungs- und Objektforschung. Hier beschäftigen sich die im Projekt tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler exemplarisch mit Objekten, die verschiedene Materialitäten, Branchen oder Epochen der Montangeschichte abdecken. Gleichzeitig gewähren sie damit einen Einblick in die verschiedenen Bestände des montan.dok – in das Bergbau-Archiv Bochum, die Bibliothek/Fotothek und die Musealen Sammlungen.
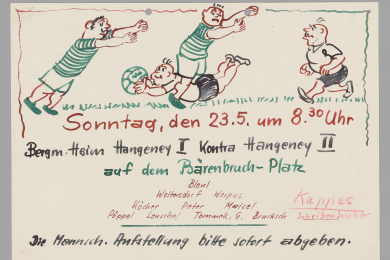
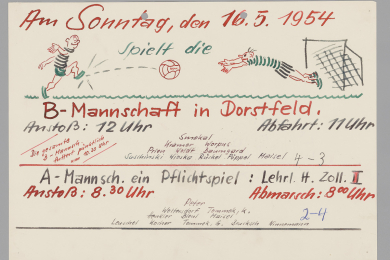
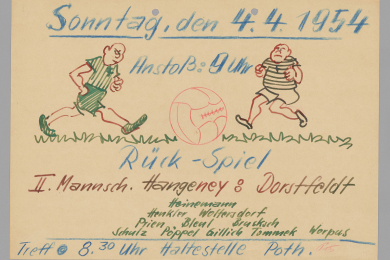

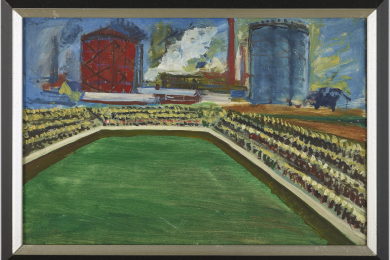
![Wilhelm Vorndamme (1869-1921), aus: isotemp®. Die durchs Feuer gehen. 100 Jahre Heinrich Vorndamme OHG, o. O. [Horn-Bad Meinberg] o. J. [2007]. Porträtfotografie eines Mannes mit Oberlippenbart](/sites/default/files/styles/image_list/public/gallery-article/Abb_01.jpg?h=64121cfb&itok=WMFRRiXo)